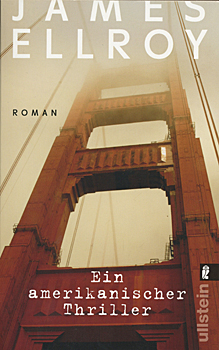Die USA 1958: Das Land lebt im Kalten Krieg. Die Behörden bekämpfen wahlweise den Kommunismus oder die Mafia. Zu den Kommuniastenbekämpfern zählt FBI-Chef J. Edgar Hoover, der es strikt abstreitet, dass es etwas gebe, wie ein Organisiertes Verbrechen. Weil Hoover aber gerne alles über alles weiß, rekrutiert er Außendienstmann Kemper Boyd und schleust ihn in Robert Kennedys Ausschuss wider die Mafia ein.
Boyd arbeitet bald für drei Geldgeber – neben dem FBI auch für Kennedy und … für die Mafia. Gleichzeitig kümmert er sich um seinen Kollegen Ward J. Littell, der es beim FBI nie so recht geschafft hat und von Hoover schließlich kaltgestellt wird. Littell recherchiert auf eigene Faust geheimen Büchern der Transportarbeitergewerkschaft unter Jimmy Hoffa nach. Wenn er doppelte Buchführung nachweisen könnte, gar, dass die Gelder in diesen Büchern auf die Mafia zurückzuführen wären, dann – so glaubt Littell – müsste er bei Robert Kennedy, dem erklärten Gegner des verhassten Hoover, ein Stein im Brett haben.
Dritter im Bunde ist Pete Bondurant, ein Frankokanadier, der seine Brötchen als rechte Hand (und Faust) Howard Hughes’ verdient. Boyd und Littell haben ihn einst hops genommen; heute braucht Boyd ihn, um in Miami die größer werdende Gruppe von Exilkubanern zu organisieren und auf einen Einmarsch in Kuba vorzubereiten. Kuba hat momentan ganz schlechte Karten, weil Fidel Castro, der sich just an Neujahr an die Macht auf der Insel geputscht hat mit den Russen kungelt und der Mafia den Zugang zu deren Casinos auf Kuba versperrt. In Miami arbeiten Männer der Mafia, der CIA und des FBI Hand in Hand am Sturz Castros. Trotzdem misslingt die Invasion der Insel in der Schweinebucht – nicht zuletzt, weil der frisch gewählte US-Präsident John F. Kennedy die Luftunterstützung für diese Operation verweigert. Und den geheimen Truppen in Florida in der Folge den Geldhahn zudreht.
In der Zwischenzeit hat Howard Hughes ein schmieriges Klatschblatt mithilfe von Mafia-Informanten und zur Freude J. Edgar Hoovers aufgezogen, sind verschiedene Mafiosi und andere Gestalten ermordet worden, haben Bondurant und Boyd JFK jede Menge Nutten und andere willige Frauen zugeführt und ist Ward J. Littell an die geheimen Teamster-Bücher gelangt, aus denen hervorgeht, dass der größte Geldgeber der schwarzen Kassen des Jimmy Hoffa Joe Kennedy ist, Vater des amtierenden Präsidenten und des amtierenden Justizministers.
Die beiden Kennedy-Brüder ahnen nichts und ziehen weiter gegen das Organisierte Verbrechen zu Felde.
Und dann haben die Herren in der Spitze der Syndikate die Schnauze voll. Sie beschließen: Kennedy muss eine Lektion erteilt werden …
aus dem Klappentext

„Was ich mir zum Ziel setzte, war, den Kennedy-Mythos zu zerstören“, wird James Ellroy in Wikipedia zitiert und weiter: „Eben diesen Mythos, der besagt, dass Amerika vor seinem Tod die reine Unschuld war, dass sein Tod uns daran gehindert hat, in ein goldenes neues Zeitalter einzutreten. Scheißdreck.“
Das ist Ellroy gelungen. Offen allerdings bleibt, was in seiner Erzählung auf Fakten basiert, was reine Fiktion bleibt. Ellroy präsentiert rund um eines der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Geschichte eine bizarre Kolportage. Vor allem die Auftritte realer Figuren sind atemberaubend – glaubt man Ellroy, war John F. Kennedy kein gelegentlicher Fremdgeher („kein Kostverächter“, wie Männer dann gerne sagen), sondern einer, der sich jede Nacht mit Nutten von der Mafia befriedigt. Howard Hughes, Bobby Kennedy, J. Edgar Hoover sind drei weitere prominente Namen, denen Dinge zugeschoben werden, gegen die deren realen Vorbilder oder deren Erben sicher juristisch vorgehen würden; von Mafiagrößen wie dem echten Sam Giancanna gar nicht zu reden. Wäre aber alles juristisch abgesichert, was Ellroy da fabuliert, dann wäre zwar weiterhin offen, wer Kennedy letztlich erschossen hat (in Ellroys Roman taucht Lee Harvey Oswald zum Beispiel gar nicht auf), aber dass es kein Einzeltäter war, wäre klar und dass strahlende Helden und finstere Killer die Geschicke der USA leiten, nicht mehr auszuschließen. Diese unklare Faktenlage stört den Lesefluss und die Leselust.
Der Roman erschien 1995 und ist so was, wie der schmuddelige Bruder des Oliver-Stone-Thrillers JFK (1991). Stone sah den militärisch-industriellen Komplex als Drahtzieher, der sich der Killer der Mafia bedient. In Ellroys Version killt die Mafia schon noch selber. Manchmal wirkt der Text, als habe Ellroy ihn als direkte Antwort auf Stones Film, der damals für ordentlich Furore sorgte, geschrieben. Zunehmend atemlos gerät dieser Text. Ist es anfangs schwierig – zumindest in der übersetzten Version – immer zuzuordnen, von wem gerade die Rede ist, lässt Ellroy seine einsilbigen Hauptsätze irgendwann stets mit dem Namen des Handelnden beginnen. Was das Lesen nicht einfacher macht.
Es ist dann auch etwas ermüdend, all den Handlungssträngen und Namen und Morden und Orten über die 630 Seiten zu folgen, die meist indirekt erzählt werden – nur dabei statt mittendrin – und doch erwartbar auf jenes große historische Ereignis am 22. November 1963 zulaufen.
Es ist ein gewagtes, in weiten Teilen gelungenes Experiment, den Kennedy-Mord als kleinen schmutzigen Polizeithriller zu erzählen, ohne den großen weltpolitischen Ballast.
Ich habe den Roman vom 29. Juli bis 8. August 2012 gelesen.
Der Autor:
„Ich wurde 1948 in L.A. geboren. Mein Vater war so ein Macher aus Hollywood – ein Buchhalter bei den Filmstudios und gelegentlich Theaterunternehmer. Meine Mutter war gelernte Krankenschwester. Ich war ihr einziges Kind. Mein Vater brachte mir mit drei Jahren das Leben bei, und Bücher wurden zu meinem Lebensunterhalt, ich las nur noch.
Als ich zehn war, wurde meine Mutter ermordet. Ein Mann hatte sie in einer Bar aufgelesen und erdrosselt. Mein Lesen konzentrierte sich daraufhin auf bestimmte Themenbereiche: Krimis und Tatsacheberichte über das Verbrechen. Ich las sie kiloweise …
Zu Beginn der 70er Jahre las ich Chandler und Ross MacDonald und flippte wegen ihrer tragischen Ausdrucksweise beinahe aus … Im Januar 1979 fing ich an „Browns Grabgesang“ zu schreiben, das war kurz vor meinem 31. Geburtstag. Den Rest wissen Sie ja..."
Als James Ellroy zehn Jahre alt war, wurde seine Mutter erdrosselt aufgefunden. Fast vierzig Jahre später recherchierte er den Fall intensiv nach und schrieb darüber das Buch „My Dark Places“ („Die Rothaarige“), das auch eine Art Autobiographie von Ellroys frühen Jahren darstellt. Ellroy verbrachte Nächte auf Parkbänken, war alkoholabhängig und über 30 Mal kurz im Gefängnis. Er hörte 1975 mit dem Trinken auf und 1977 mit den Drogen. Im Alter von 31 Jahren begann er seinen ersten Roman („Browns Grabgesang“) in einem schäbigen Hotelzimmer zu schreiben (der Legende nach im Stehen). Ellroy, der Kriminalromane in großer Menge gelesen hatte, setzte sich zum Ziel, „der größte Kriminalautor aller Zeiten“ zu werden. Seine erklärten Vorbilder sind Dashiell Hammett, Joseph Wambaugh sowie Raymond Chandler und Ross Macdonald.
James Ellroy ist zwei Mal geschieden und hatte in den letzten Jahren einen Nervenzusammenbruch auf einer Buchtour.
Text: Wikipedia
Der Roman gehört zur Urlaubslektüre 2012. James-Ellroy-Romane reizen mich, seit ich „L.A. Confidential“ im Kino gesehen und in dem Zusammenhang hymnische Texte auf Ellroy gelesen habe. Im Sommer 2012 ergibt sich die Gelegenheit. Angereichert wird meine Lust zu lesen durch das Thema: Die Ereignisse rund um die Ermordung Kennedys interessieren mich (real wie fiktional), seit Oliver Stones Film JFK – Tatort Dallas (1991) meine Zweifel an der offiziellen Version geweckt haben.
Weitere Urlaubslektüre 2012: James Ellroys Ein amerikanischer Albtraum.