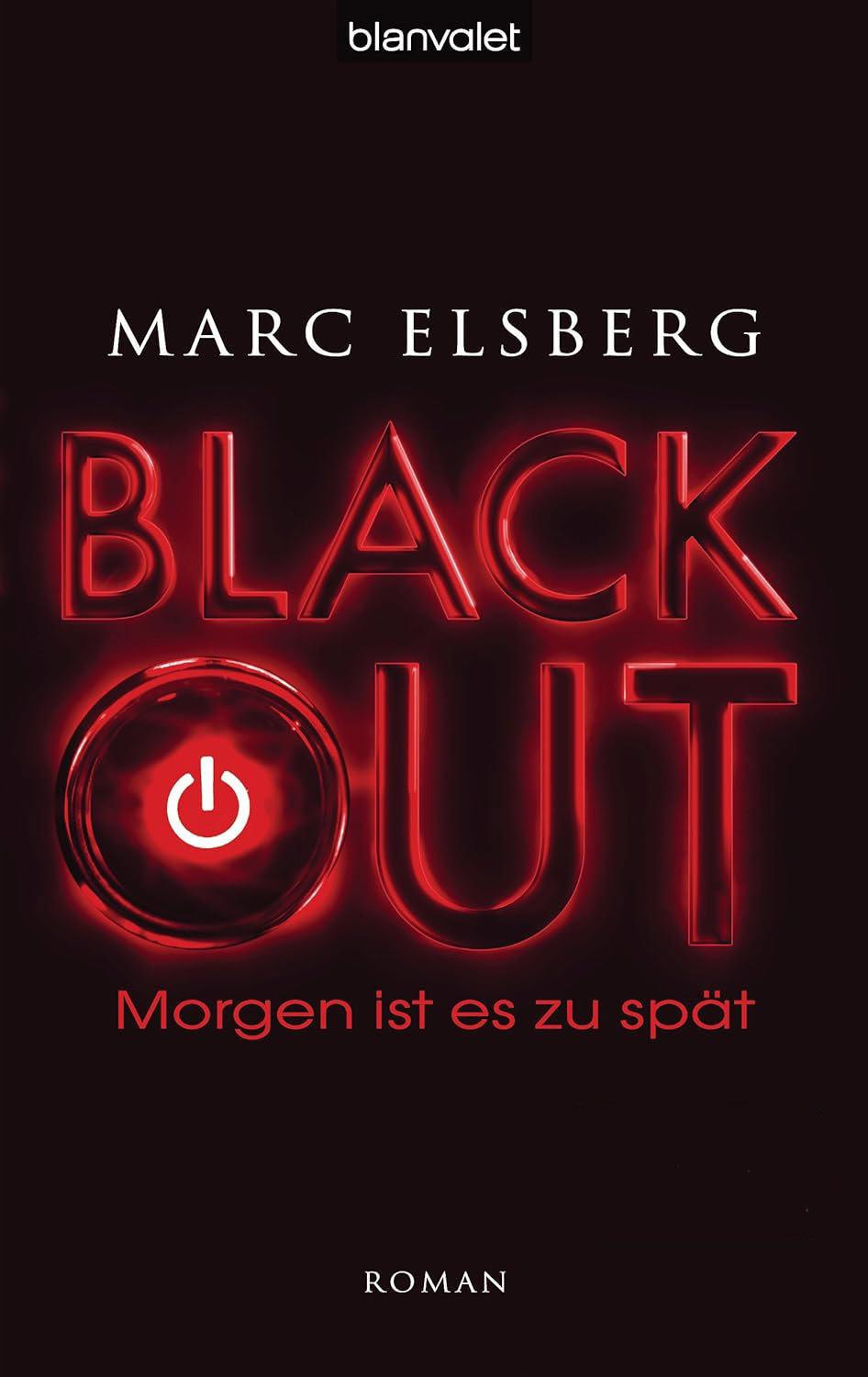An einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Der totale Blackout. Der italienische Informatiker Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff und versucht, zu den Behörden durchzudringen – erfolglos.
Als Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauchen in Manzanos Computer dubiose E-Mails auf, die den Verdacht auf ihn selbst lenken. Er ist ins Visier eines Gegners geraten, der ebenso raffiniert wie gnadenlos ist. Unterdessen liegt ganz Europa im Dunkeln, und der Kampf ums Überleben beginnt …
aus dem Klappentext

Das geht gut los: mit dem Ausfall einer Ampel an einer nächtlichen Straßenkreuzung im Schneetreiben. Subjektiv erzählt erleben wir eine Autokollision, bei der der oben erwähnte Charakter Piero Manzano sein sportliches Auto für immer verliert, dafür sein Leben einigermaßen unverschrammt behält. Dann springt der Roman durch verschiedene Länder Europas, in denen viele Figuren in vielen Kontroll- und Schaltstellen und in Entscheidungsgremien ratlos auf Bildschirme starren und glauben Das ist in ein paar Stunden vorbei. Da bin ich kurz versucht, das Buch schon wieder weg zu legen: Soll ich mir einen Zettel holen und all die Namen und Funktionen notieren, damit ich die später wiedererkennen werde?
Muss ich nicht.
Irgendwann beginnen die vielen Charaktere eine Interaktion mit ihrer jeweiligen Umgebung und prompt erreicht das Buch eine Balance; tatsächlich kann ich mir die vielen Charaktere merken, ohne mir alle Namen zu notieren. Bald ist auch eine Spur hin zu einem offenbar kriminellen Hintergrund aufgedeckt. Aber wie das so ist mit Behörden und Konzernen; die einen haben genug mit dem zusammengebrochenen Alltag zu tun, die anderen wollen ihre Geschäftsinteressen nicht gefährden.
Bald ist der Punkt erreicht, wo ich das Buch schon wieder aus der Hand legen möchte. Das Szenario wird mir zu realistisch, als die Menschen den Firnis ihrer Zivilisation verlieren und nur noch sich selbst am nächsten sind; wenn Menschen wider besseren Wissen mit Wut und Gebrüll Einlass in eine kleine, unabhängig mit Strom und Wärme versorgte Herberge fordern, in der erkennbar kein Platz mehr ist. Unangenehm zu lesen, weil: Mache ich das auch, wenn es mal soweit ist? Überhaupt lese ich mit zunehmender Ungemütlichkeit, weil ich darauf gestubst werde, dass ich für einen Blackout-Ernstfall nicht vorbereitet bin.
Elsberg verknüpft seine Thrillerhandlung mit recherchiertem Wissen. Da werden manche Seiten zu Wikipediaeinträgen für Reaktorsicherheit, andere ausführliche Erklärungen wirken, wie der Kern eines Schulreferates über Sicherheitsstrukturen. Das macht die Lektüre hin und wieder mühsam, weil man viel von dem, was im Moment für die Welt in diesem Roman wichtig ist, wieder vergisst, wenn man das Buch zugeklappt hat.
Elsberg verteilt seine Protagonisten über halb Europa. In Italien beginnt und endet das Drama, in Frankreich, Österreich, Deutschland, Den Haag und Brüssel sind die zentralen Schauplätze, zwischen denen der Autor in kurzen Kapiteln, die den jeweiligen Schauplatz in der Überschrift tragen, springt. Damit führt er uns aus dem Krisenstab des Bundeskanzlers in Berlin über die kleinteilige Ermittlungsarbeit in der Europol-Zentrale zu rastlos nach Fehlern forschenden Technikern in großen Kraftwerken bis hin zu einfachen Bürgern, die das Schicksal in eine überfüllte Notunterkunft in Orléans zwingt. Damit erfasst den Leser dieser gigantische Blackout auf allen Ebenen. Zwischendurch havarieren Kernkraftwerke und schicken radioaktive Wolken über das Loire-Tal und Norddeutschland.
Realistisch beschreibt Elsberg auf mehr als 800 Seiten, wie die Gesellschaften und Länder Europas – und später auch die der USA – die Kontrolle verlieren. Zu Anfang stehen wir nur in einer abendlichen Schlange vor einer Tankstelle an der Autobahn, deren Zapfsäulen mangels Strom keinen Sprit mehr liefern. Schon am nächsten Morgen riecht die ganze Gegend nach menschlichen Hinterlassenschaften, weil auch keine Toiletten mehr funktionieren. Nach wenigen Tagen wird die Nahrung knapp. Während die Menschen im kalten Februar ohne Heizung und Warmwasser erbärmlich frieren, verdirbt die Tiefkühlware in nicht mehr kühlenden Kühlhäusern, krepieren in den Ställen die Kühe, deren Euter von keiner elektrischen Melkmaschine mehr gemolken werden, während die Bauern nicht mehr hinterherkommen, weil sie gigantische Betriebe mit mehreren hundert Kühen bewirtschaften. Später geistert eine Giraffe durch Berlin, auf die im Zoo niemand mehr aufpasst, liegt am Straßenrand der Kadaver eines geschlachteten Elefanten, den jemand in seiner Not gegessen hat. Das wirtschaftlich große Europa liegt nach wenigen Tagen ausgebrannt am Boden.
Sprachlich ist das Buch kein Erweckungserlebnis, ordentliche Thrillersprache. Da werden vernichtende Blicke geschickt, Befehle gebellt, wissen knallharte Polizisten, dass sie Anschnauzen jetzt nicht weiterbringt. Die Hauptfigur ist ein italienischer Hacker, der alle Geheimnisse der Terroristen im Alleingang löst, während Europol, BKA, BND und CIA mit ihren riesigen Apparaten staunend daneben stehen, weil deren Beamte eben immer nach Vorschrift und möglichst so arbeiten, dass sie keines Fehlers überführt werden können, während der Hacker einfach mal unorthodox guckt, woran's denn liegen könnte.
Diese Schwächen fallen aber kaum ins Gewicht, weil der Leser viel zu sehr mit der geschilderten Welt hadert, die ihm vor Augen führt, wie dünn die Grenze zwischen behaglicher Sicherheit und brutaler Wildnis ist, in der der Mensch zu des Menschen Wolf wird, der Schwarzmarkt blüht, für einen Kanister Benzin getötet wird und sogar riesige Bahnhofsgebäude keinen Unterschlupf mehr bieten, weil überall schon Menschen die letztes Fleckchen Trockenheit besetzt halten. Während bewaffnete Marodeure die Städte plündern, vermummt sich ein Großteil der Bevölkerung in schützende Ecken und Notunterkünfte und besteht darauf, dass die Zuständigen jetzt aber mal zu Potte kommen sollen; die Aktiven in dieser Krise plündern, die Passiven schimpfen auf den Staat und die da Oben.
Ein beeindruckender Roman, auch noch 13 Jahre nach seiner Erstauflage. Eine zentrale Schwäche des damals beschriebenen europäischen Stromverbunds ist, dass damals Energie noch nicht in großem Maße gespeichert werden konnte. Das ist mittlerweile möglich. Dafür werden in Deutschland gerade sukzessive jene digitalen Stromzähler verbaut, wie sie ähnlich im Roman das Einfallstor für die Terroristen darstellen. Und heute ist es ein Allgemeinplatz: Digitale Systeme sind immer an irgendeiner Stelle angreifbar. Schon während der Lektüre habe ich mich im Supermarkt länger bei den Konservendosen und Wasserkisten umgeschaut, die ich doch mal im Dutzend besorgen könnte, um ein Notreservoir im Keller anzulegen.
Ich habe "Blackout" zwischen dem 7. und 16. Oktober 2025 gelesen.
Der Autor:
Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung "Der Standard". Heute lebt und arbeitet er in Wien.
Mit seinen internationalen Bestsellern "Blackout", "Zero" und "Helix" wurde er zum Meister des Science-Thrillers. Mit "Gier" lieferte er einen spannenden Thriller und zugleich eine Kritik des allgegenwärtigen Wettbewerbs, mit "Der Fall des Präsidenten" einen fesselnden Politthriller und mit "°C – Celsius" einen außergewöhnlichen Klimathriller. Jedes seiner Bücher ist ein Bestseller und er ein gefragter Gesprächspartner für Politik und Wirtschaft.