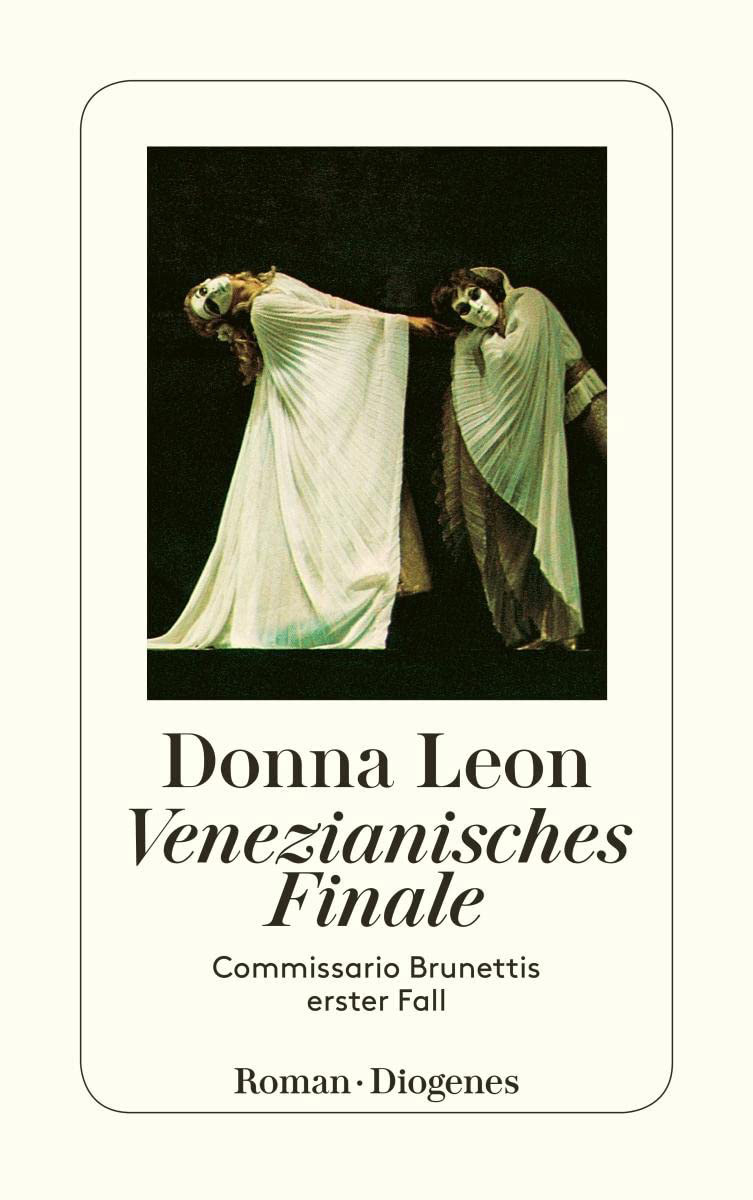Skandal in Venedigs Opernhaus "La Fenice": In der Pause vor dem letzten Akt der Traviata wird der deutsche Stardirigent Helmut Wellauer tot aufgefunden. In seiner Garderobe riecht es nach Bittermandel – Zyankali.
Ein großer Verlust für die Musikwelt und ein heikler Fall für Commissario Guido Brunetti. Und es scheint, als ob einige Leute allen Grund gehabt hätten, den Maestro unter die Erde zu bringen …
aus dem Klappentext

Ein Kriminalroman mit einem eher schweigsamen, abwartenden Ermittler, der uns bei seiner Arbeit durch halb Venedig führt und gerne auf dem Weg von A nach B einen Espresso in einer der zahlreichen kleinen Bars trinkt. Dieser Commissario Brunetti ist Kulturfreund, geht gerne in die Oper und als er also vor dem toten Dirigenten steht, weiß er gleich alles: Großer Künstler, einzigartiges Genie, weltberühmt, soll mit Nazis gemauschelt haben. Was er nicht erkennt, ist ein Motiv.
Einen Großteil des Buches macht also des Commissarios Suche nach dem privaten Menschen hinter dem Dirigenten aus. Brunetti fragt nie, Wo waren Sie gestern Abend. Er ist überzeugt, der Täter findet sich, wenn er den Toten und seine dunklen Seiten kennt. Schüsse fallen in der ganzen Zeit keine. Es fallen auch nicht weitere Leichen vom Balkon, während Brunetti seine Ermittlungen führt und Donna Leon uns das gesellschaftliche Leben in der offenbar überschaubaren Stadt Venedig näher bringt: „Viele der Anwesenden waren ihm bekannt, aber eher aus zweiter Hand. Auch wenn er ihnen nie vorgestellt worden war, kannte er doch ihre Skandale, ihre Geschichten und ihre Affären, rechtliche wie romantische. Teils hing das mit seinem Beruf als Polizist zusammen, hauptsächlich aber damit, daß sie eigentlich in einer Provinzstadt wohnten, in der Klatsch der wahre Kult war und in der die herrschende Gottheit, hätte es sich nicht wenigstens dem Namen nach um eine christliche Stadt gehandelt, sicher »Gerücht« geheißen hätte.“ Folglich sammelt der gebürtige Venezianer auch jede Menge Klatsch und Gerüchte ein, um sein Bild von dem Toten abzurunden. Spuren führen in die Zeit des deutschen Nationalsozialismus, dem der tote Dirigent, ein Deutscher, offenbar besonders gern zu Diensten war, auch Verbindungen zum italienischen Pendant Mussolini werden gezogen. Aber das bleiben Nebelkerzen, nichts sonst deutet nur ansatzweise auf irgendwelche Naziverstrickungen als Motiv hin.
Der Commissario legt Wert auf Professionalität. Donna Leon lässt ihn wiederholt seine eigenen Verhörtechniken hinterfragen, erkennt, wo er besser geschwiegen hätte, wo er irreführend gefragt hat. Das bremst den Lesefluss, gibt aber der Hauptfigur einen tiefsinnigen Charakter. Dieser Mann ruht sich nicht aus, lässt sich nicht blenden. Auch nicht von seinem eitlen, aber begrenzt begabten Vorgesetzten, einem Mann aus Sizilien, der womöglich die richtige Verwandtschaft für seine hohe Position hat – die kleine Korruption ist die tägliche Begleiterin in dieser Stadt. Als sich Brunetti in einer Wohnung einmal nach den wunderschönen Dachfenstern erkundigt, die in einer Stadt wie Venedig eigentlich niemals genehmigt würden, und sein Gegenüber anstandslos antwortet, er habe das Bauamt bestochen, fragt Brunetti ungerührt „Wieviel war's denn?“
Viel Wert – wir sind in Italien – wird aufs Essen gelegt. Die Protagonisten essen gerne und gut: „Auch er brach ab, während Antonia ihm seinen Salat hinstellte. Er machte ihn sich zurecht, viel zu viel Essig für Brunettis Geschmack.“ Bei Abendessen in der heimischen Wohnung lernen wir die Familie Brunetti kennen, Ehefrau Paola, Sohn Raffaele und Tochter Chiara. Paola, Professorin für englische Literatur, nimmt bei einem, oder zwei Glas Rotwein regen Anteil am kriminalistischen Leben ihres Mannes, während Rafaele, der Teenager, gerade die sozialistische Revolution für sich entdeckt und Chiara die Sache mit der Liebe noch nicht versteht. Mit solchen Nebenhandlungen schafft Donna Leon ein warmherziges, buchstäblich familiäres Umfeld, zu dem auch der ein oder andere Barmann gehört, der Brunetti grüßt, ohne ihn mit Fragen zum aktuellen Fall zu belästigen – der tote Dirigent war immerhin ein Superpromi.
Leon nutzt etwas zu häufig abgewandelte Floskeln aus der Kategorie Falls er überrascht/erbost/gekränkt war, ließ er sich das nicht anmerken. Darüber lese ich hinweg und begleite den Commissario durch die Gesellschaft Venedigs, bekomme viel Lokalkolorit und ein interessantes Stammpersonal aus eitlen Vorgesetzten, etwas denkfaulen Inspektoren, einer charmanten Ehefrau und einem kulturell vorgebildeten Commissario, der lieber die Befragten reden lässt, als sie mit weiteren Fragen in ihrer Erinnerung zu stören und auf diese Weise einer widerlichen Wahrheit auf die Spur kommt.
Ich habe "Venezianisches Finale" zwischen dem 11. und 13. September 2025 gelesen.
33 Jahre, nachdem dieser erste Roman von Donna Leon in die Bücherregale kam, lese ich zum ersten mal einen Commissario-Guido-Brunetti-Buch. Jedes Jahr, seit 1992, kommt ein Brunetti-Roman auf den Markt und jedes Jahr hat mich das nicht interessiert. Mein Leben fand an anderer Stelle in anderen Sphären und mit anderen Büchern statt. Jetzt bin ich wohl alt genug, um mal zu gucken, ob ich Gefallen an Commissario Brunetti finden kann.
Die Autorin
Donna Leon, geboren 1942 in New Jersey, arbeitete als Reiseleiterin in Rom und als Werbetexterin in London sowie als Lehrerin und Dozentin im Iran, in China und Saudi-Arabien. Die Brunetti-Romane machten sie weltberühmt. Donna Leon lebte viele Jahre in Italien und wohnt heute in der Schweiz. In Venedig ist sie nach wie vor häufig zu Gast.
Von 1981 bis 1995 war sie an der Außenstelle der Universität Maryland auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Vicenza (Norditalien) tätig.
Ihre Dissertation über Jane Austen konnte sie nicht abschliessen, da der Entwurf, die Bücher und sämtliche Notizen, an denen sie fünf Jahre lang gearbeitet hatte, 1979 während der Flucht vor der islamischen Revolution im Iran verloren gingen.
„Das ist wahrscheinlich das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Wenn ich das Konzept nicht verloren hätte, hätte ich die Doktorarbeit beendet und mein Leben als Akademikerin zugebrach“, sagte Leon der Rhein-Neckar-Zeitung.
Die Idee zu ihrem ersten Buch "Venezianisches Finale" kam ihr 1992 während eines Opernbesuchs im Teatro La Fenice in Venedig. Bei einer Unterhaltung mit dem Dirigenten Gabriele Ferro und seiner Frau wurden Anekdoten und Klatsch über den verstorbenen Stardirigenten Herbert von Karajan und dessen Tod ausgetauscht. Das Gespräch eskalierte, die drei sprachen schließlich über Mord in einer Operngarderobe.
„Ich fand das eine interessante Art, einen Kriminalroman zu beginnen. Und da dachte ich, ich schreibe mal einen.“
Die Brunetti-Romane
Die deutschen Buchausgaben sind alle im Zürcher Diogenes Verlag erschienen, zuerst als Hardcover, dann als Taschenbuch (detebe).
- Venezianisches Finale (Death at La Fenice, 1992)
- Endstation Venedig (Death in a Strange Country, 1993)
- Venezianische Scharade (The Anonymous Venetian, 1994)
- Vendetta (Death and Judgment, 1995)
- Acqua Alta (Acqua Alta, 1996)
- Sanft entschlafen (Quietly in Their Sleep, 1997)
- Nobiltà (A Noble Radiance, 1998)
- In Sachen Signora Brunetti (Fatal Remedies, 1999)
- Feine Freunde (Friends in High Places, 2000)
- Das Gesetz der Lagune (A Sea of Troubles, 2001)
- Die dunkle Stunde der Serenissima (Wilful Behaviour, 2002)
- Verschwiegene Kanäle (Uniform Justice, 2003)
- Beweise, dass es böse ist (Doctored Evidence, 2004)
- Blutige Steine (Blood from a Stone, 2005)
- Wie durch ein dunkles Glas (Through a Glass, Darkly, 2006)
- Lasset die Kinder zu mir kommen (Suffer the Little Children, 2007)
- Das Mädchen seiner Träume (The Girl of His Dreams, 2008)
- Schöner Schein (About Face, 2009)
- Auf Treu und Glauben (A Question of Belief, 2010)
- Reiches Erbe (Drawing Conclusions, 2011)
- Tierische Profite (Beastly Things, 2012)
- Das goldene Ei (The Golden Egg, 2013)
- Tod zwischen den Zeilen (By its cover, 2014)
- Endlich mein (Falling in Love, 2015)
- Ewige Jugend (The Waters of Eternal Youth, 2016)
- Stille Wasser (Earthly Remains, 2017)
- Heimliche Versuchung (The Temptation of Forgiveness, 2018)
- Ein Sohn ist uns gegeben (Unto Us a Son Is Given, 2019)
- Geheime Quellen (Trace Elements, 2019)
- Flüchtiges Begehren (Transient Desires, 2021)
- Milde Gaben (Give Unto Others, 2022)
- Wie die Saat, so die Ernte (So Shall You Reap, 2023)
- Feuerprobe (A Refiner’s Fire, 2024)