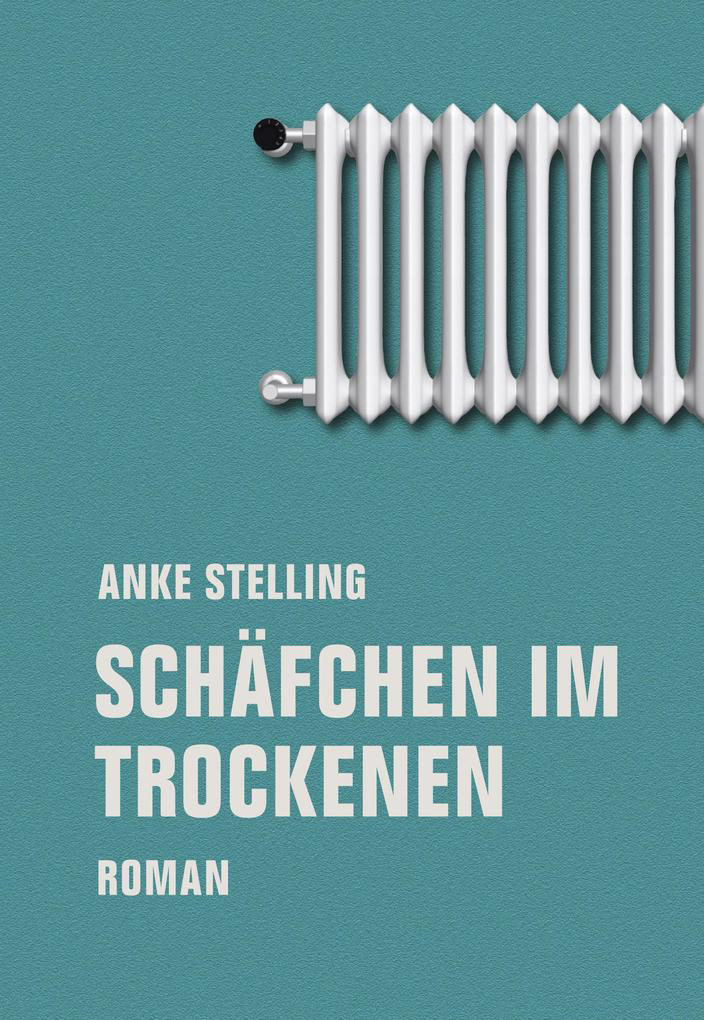Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die sicherste Wohnform darstellt, denn: Was ist Freundschaft? Die hört bekanntlich beim Geld auf. Die ist im Fall von Resis alter Clique mit den Jahren so brüchig geworden, dass Frank Lust bekommen hat, auszusortieren, alte Mietverträge inklusive.
Resi hätte wissen können, dass spätestens mit der Familiengründung der erbfähige Teil der Clique abbiegt Richtung Eigenheim und Abschottung und sie als Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da mithält.
Aber Resi wusste es nicht. Noch in den Achtzigern hieß es, alle Menschen wären gleich und würden durch Tüchtigkeit und Einsicht demnächst auch gerecht zusammenleben. Das Scheitern der Eltern in dieser Hinsicht musste verschleiert werden, also gab's nur drei Geschichten aus dem Leben ihrer Mutter, steht nicht mehr als ein Satz in deren Tagebuch. Darüber ist Resi reichlich wütend. Und entschlossen, ihre Kinder aufzuklären, ob sie's wollen oder nicht. Sie erzählt von sich, von früher, von der Verheißung eines alternativen Lebens und der Ankunft im ehelichen und elterlichen Alltag.
Und auch davon, wie es ist, Erzählerin zu sein, gegen innere Scham und äußere Anklage zur Protagonistin der eigenen Geschichte zu werden …
aus dem Klappentext

Die Zeit, in der das Leben sich diversifiziert, wenn es sich aufteilt in viele Leben. Wenn der Mensch diese Grenze überschreitet, die in diesem Satz von – angeblich – Winston Chruchill anklingt: „Wer als 20-Jähriger kein Linker ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch ein Linker ist, hat keinen Verstand.“
In Anke Stellings Roman ist dieser Moment der Grenzüberschreitung erreicht, als sich die besten Freunde seit Kindertagen im Schwäbischen jetzt in Berlin in ihren individuellen Vorstellungen etablieren und plötzlich Friktionen erkennbar werden, die auch etwas mit der sozialen Herkunft zu tun haben. Als Kinder waren sie alle gleich. Da waren nur die Eltern von unterschiedlicher Herkunft (was die Kinder aber nicht interessierte): „Ich, die ihre Abstammung ohnehin nur bis zu den Opas, die meine Eltern jeweils noch persönlich gekannt hatten, zurückverfolgen konnte, und er, dessen Stammbaum als ein in Leder gebundenes Buch bei seinen Eltern in der Vitrine stand.“ Jetzt haben die einen aus ererbtem Vermögen eine Baugruppengemeinschaft gestaltet, damit die Kinder in vertrauter Umgebung aufwachsen und die Erwachsenen sich ihren Traum von der gehobenen Wohngemeinschaft unter Gleichen erfüllen können, und die andere sich aus einfachen Verhältnissen – ohne Erbmasse – als Schriftstellerin einrichtet und ein erfolgreiches Buch geschrieben hat – das dieses Wohnprojekt zum Thema hatte und das ist das Ende der großen Gemeinschaft. Die Bauherren fühlen sich von der Freundin verraten – „Du hättest was anderes schreiben können“ –, die Freundin, für die Schreiben können und Stoffauswahl nicht zu trennen sind, unverstanden.
Es geht um zerfließende Ideale, diffundierende Träume und die Unfähigkeit, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Erzählt wird aus Resis Perspektive. Das ist die Autorin, die das möglicherweise schlimme Buch geschrieben hat. Resi tobt durch eine Art Tagebuch. Sie schreibt für sich und ihre Tochter Bea auf, wie es so weit kam, wie sie in einfachen Verhältnissen aufwuchs, sich in die Illusion hineinlebte, sie könne wie ihre Freundinnen und Freunde zum gehobenen Selbstverwirklichungsmilieu dazugehören, wie sie die Illusionen verlor, aus dem Freundeskreis verstoßen und zum Neuanfang verdammt wurde. Ihr Ich-Erzählstil wendet sich mal direkt und ungekünstelt an die 14-jährige Bea, dann wechselt die Haltung und sie erzählt chronologisch, oder sie geistert durch ihre Gedankenwelt, in der sie kein Opfer sein will. Die von ihr selbst formulierten gegenseitigen Vorwürfe enden immer im Schachmatt. Sie habe doch nur ein Buch geschrieben. Aber Sie hätte vorher fragen müssen, ob die Freunde einverstanden sind. Aber sie sei doch Schriftstellerin. Ah, jetzt spiele sie das Opfer, obwohl sie doch Täterin sei.
Resi, Ehefrau und vierfache Mutter, ist in ihren Tagebucheintragungen im Dauerstreit mit sich. Weil sie in Folge dieses kleinen Bucheklats nun auch aus ihrer geliebten Wohnung geworfen wird, schreibt sie sich in die Büßerrolle. Versucht zu verstehen, warum Frank, Jugendfreund, Hauptmieter ihrer Wohnung und jetzt Teil des neuen Wohnprojektes über ihren Kopf hinweg den Mietvertrag gekündigt hat: „Ich bin die Königin des Verstehens. Verstehen ist ein äußerst wirksames Betäubungsmittel für hungrige, schmerzende Herzen, viel besser als Wut, weil die Wut irgendwann einen Ausbruch braucht, wenn man nicht ersticken oder platzen will an ihr, und wer weiß: Am Ende trifft sie noch den Falschen oder war von vornherein überzogen, unberechtigt gar. Auf jeden Fall ist sie riskant, weil sie laut ist und weithin sichtbar. Wer wütend wird, ist schon zum Opfer geworden, wer versteht, hat sich selbst in der Hand.“ Verständnis wird zur Waffe gegen die Freunde von gestern, die mit Ausschluss ahnden, was das eigene Niveau nicht hält. Auf welche Weise den feinen Unterschieden großstädtischer Lebensstile grobe ökonomische Differenzen zugrundeliegen, zeigt der Roman ebenso wie Taktiken, das zu verstecken, zu überspielen. Oft gesagt: „Ich weiß nicht, wie du das schaffst“, was in Resis Ohren klingt wie: „Mit dir will ich auf keinen Fall tauschen.“ Das wirksamste Argument: Sie habe ihre Chance gehabt, solle sich nicht zum Opfer stilisieren. Dagegen wird die eigene Lebensgeschichte, der gesamte Roman aufgeboten.
Zum großen Streitgespräch kommt es nicht mehr. Die Freundschaft diffundiert im Stillen. Die Kündigung des Mietvertrages kommt nur in Kopie, ihre Sandkastenfreundin Vera schickt eine letzte „Unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende“-E-Mail. Für den Leser wird es ab da schwierig. Wir verfolgen den wachsenden Zorn einer vierfachen Mutter, die mit einem Sven, wie sie ein Künstler, verheiratet ist, der sich aus allen Erziehungs- und Haushaltsfragen raushält und auch sonst wenig sagt – ihre Ehe sei durch vier gemeinsame Kinder besiegelt, erklärt Resi an einer Stelle. Liebe? Keine Liebe mehr? Erschöpfung scheint ihren Zustand am besten zu umschreiben. Aber dann ist Sven es, der am Ende ebenso cool wie pragmatisch seiner Frau die Angst vor einem Umzug in die Peripherie nach Marzahn nimmt: „Wir ziehen nicht nach Marzahn.“ Mehr sagt er dazu nicht, als er kurz vor knapp endlich doch mit der Kündigung des Mietvertrages konfrontiert wird.
Die irgendwie doch erfolgreiche Autorin, die sich in die Kreise ihrer Freunde hochgearbeitet hat, hat im Buch schnell erkannt, dass die gemeinsamen Träume aus ihrer Kindheit von der Gleichheit aller Menschen doch nur Träume sind. Jetzt hadert sie mit ihren Ex-Freunden und das Buch dreht sich im Kreis. Weitere Erkenntnisse gibt es nicht. Gelegentliche Wiederannäherungsversuche über ihren Ex-Freund Ulf an die Clique folgen dem immer gleichen Gesprächsmuster: Du bist schuld und jetzt gerierst Du Dich als Opfer. Komm mal klar. Und sie versteht nicht, warum keiner versteht, was das Wesen der Arbeit einer Autorin eigentlich ist. Er, der Junge aus alter Familie, greift dabei zum Bier, wodurch er „seine Bereitschaft (betont), sich dem Proletariat zuzuwenden“, wie sie konstatiert, während sie ein Glas Wein bestellt und dem Leser aber gleich gesteht, sie kenne nicht den Unterschied „zwischen Cabernet und Bordeaux und Pinot noir, hätte ihn längst lernen können, bluffe stattdessen, indem ich beim Bestellen so tue, als müsse ich kurz überlegen.“
Zwischen dieses große Drama aus Selbstverwirklung, Selbstzweifel und Selbstverleugnung baut Anke Stelling schöne Alltagsbeobachtungen über die Schwierigkeiten, einen Holzdielenboden sauber zu halten, Holzdielen seien viel schöner als PVC, aber PVC eben einfacher zu reinigen: „Sagen wir mal so: Einfarbige Terrakottafliesen mit Fußbodenheizung sind okay – wenn man eine Putzfrau hat, die sich ständig um sie kümmert.“ Das Buch ist eine sarkastische Beobachtung der Generation Selbstverwirklichung mit der ein oder anderen Ausschweifung ins Larmoyante, mit präzisen Situationsbeschreibungen und gelegentlichen Gedankensprüngen, bei denen ich den Faden verliere.
Ich habe "Schäfchen im Trockenen" zwischen dem 29. September und 3. Oktober 2025 gelesen.
Die Autorin:
Anke Stelling, 1971 in Ulm geboren, absolvierte ein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. 2004 wurde ihr gemeinsam mit Robby Dannenberg verfasster Roman "Gisela" verfilmt, 2010 die Erzählung "Glückliche Fügung". Weitere Veröffentlichungen: "Nimm mich mit" (2002, gemeinsam mit Robby Dannenberg), >"Glückliche Fügung" (2004) und "Horchen" (2010).
Anke Stelling stand mit ihrem im Verbrecher Verlag erschienenen Roman "Bodentiefe Fenster" (2015) auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2015. Zudem wurde der Roman mit dem Melusine-Huss-Preis 2015 ausgezeichnet. Zuletzt erschien der Roman "Fürsorge" (2017).